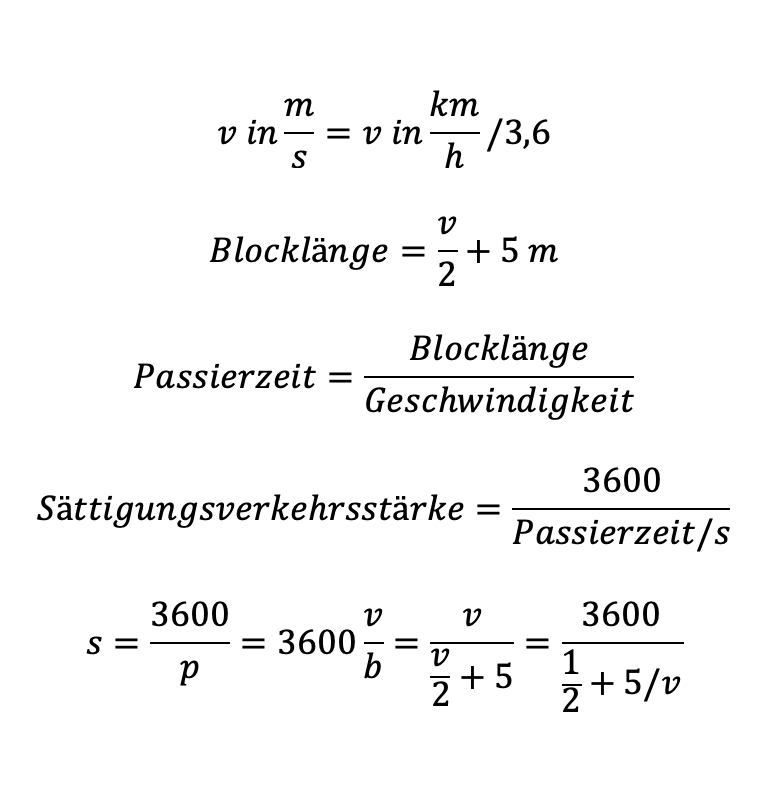Exec Summary
Das Home Office wird gerne als der wünschenswerte Zielzustand des durchdigitalisierten modernen mobilen Arbeitsplatzes gesehen.
Im Folgenden werde ich „Home Office“ ohne Anführungszeichen schreiben, obwohl der Begriff für Native English Speakers eher mit dem Innenministerium verbunden ist.
Die Corona-Pandemie hat bewiesen, dass erhebliche Anteile der Dienstleistungsarbeitsplätze im Home Office möglich sind.
In diesem Text zeigen wir, dass dieser Home-Office-Arbeitsplatz agilen Kernwerten widerspricht.
Home Office ist eben grundsätzlich von teamweise an einem Ort arbeitender Beschäftiger zu unterscheiden. Diese Form wird Verteiltes Arbeiten genannt.
Dieser Art des Verteilten Arbeitens wird hohe Agilität und damit eine erhebliche Wertgenerierung unterstellt. Zudem erzeugt diese Form des Verteilen Arbeitens noch andere (in einem anderen Text betrachteten) Effekte:
- Drastische Reduktion des Pendelverkehrs.
- Reduktion des Bürobedarfs in Hochpreis-Arealen.
- Wiederbelebung der Unterzentren.
- Work-Life-Balance insbesondere für junge Familien.
Arbeitshypothesen
Individuals and Interactions over processes and tools
https://agilemanifesto.org
Meine Arbeitshypothesen aus Satz 1 des Agile Manifestes sind:
- Computer sind Tools. Menschen sind Individuen.
- Dass Menschen miteinander interagieren ist wichtiger als einen guten Jira-Workflow zu haben.
- Seiner Kollegin wortlos etwas in den (elektronischen) Eingangskorb zu legen, ist keine Interaktion.
- Interaktion ist Kommunikation. Computer als Interaktionspartner sind prinzipiell rückkopplungsarm, daher ist eine zweifach indirekte Interaktion (auf Senderseite und dann noch einmal auf Empfängerseite) über Computer prinzipiell der direkten Interaktion von Individuen unterlegen.
Zusammengefasst gilt:
Die beste Interaktion ist eine direkte Interaktion.
Working software over comprehensive documentation
https://agilemanifesto.org
Meine Arbeitshypothesen aus Satz 2 des Agile Manifestes sind:
- Umfangreiche Dokumentationen werden in isolierter Einzelarbeit erstellt.
- Dass Software funktioniert, erkennt man am besten, indem man sie ausprobiert, testet, mit ihr interagiert.
- Das etwas funktioniert, findet man am besten in einem Team von Fachleuten heraus, nicht, indem man das dem einzelnen (sic!) Entwickler überlässt.
Zusammengefasst gilt:
Funktionierende Software existiert erst dann, wenn die Funktionstüchtigkeit (jemandem, durch jemanden) gezeigt wurde.
Customer collaboration over contract negotiation
https://agilemanifesto.org
Meine Arbeitshypothesen aus Satz 3 des Agile Manifestes sind:
- Jeder Abnehmer eines Produktes/Artefaktes ist in diesem Sinne Kunde.
- Ein Vertrag verschriftlicht Anforderungen aneinander. Vertragsverhandlungen sind Interaktionen über den Inhalt gegenseitiger Anforderungen. D.h. es wird mit einem Vertrag „über Bande“ gespielt.
- Der direkte Austausch ist oft besser als eine ausgehandelte Verschriftlichung.
Zusammengefasst gilt:
Verträge liefern oft notwendige Leitplanken für gute Zusammenarbeit. Gute Zusammenarbeit geschieht aber am besten über möglichst unmittelbaren Austausch.
Responding to change over following a plan
https://agilemanifesto.org
Meine Arbeitshypothesen aus Satz 4 des Agile Manifestes sind:
- Veränderungen sind Teil der Realität.
- Ein Plan ist ein statisches Zielmodell über die Zukunft.
- Je schneller und je besser ich auf Veränderungen reagiere, umso besser wird mein Produkt.
- Veränderungen bekomme ich nur mit, wenn ich permanent und schnell interagieren kann.
- Aus Veränderungen resultieren sofort Planänderungen. Aus Planänderungen resultieren sofort Änderungen der Arbeitspakete, d.h. der Aufgaben jedes Teammitgliedes.
- Nur die direkte Interaktion stellt sicher, dass die Betroffenen die Veränderung registriert und verstanden haben. Nur die direkte Interaktion stellt sicher, dass die betroffenen eine Planänderung registriert und verstanden haben.
Zusammengefasst gilt:
Auf Veränderung reagiere ich am besten schnell. Direkte Interaktion liefert die schnellste Reaktion. Planänderungen sind Veränderungen.
Argumente gegen das Home Office
Home Office erfüllt die Voraussetzungen für agile Zusammenarbeit aus den folgenden Gründen nur schlecht:
- Direkte Kommunikation, d.h. Interaktion ist im Home Office prinzipiell nicht möglich.
- Die Interaktionsqualität wird maßgeblich von den eingesetzten Werkzeugen bestimmt und nicht durch die Qualifikation der Beschäftigten.
- Veränderung wird immer gefiltert und verzögert registriert, womit auch die Antwort auf Veränderung gefiltert und verzögert eintritt.
Argumente für Verteiltes Arbeiten
Verteiltes Arbeiten als Arbeiten in einem Team am gemeinsamen Ort erfüllt alle Voraussetzungen für agile Zusammenarbeit aus den folgenden Gründen perfekt:
- Team-Interaktion ist jederzeit von Angesicht zu Angesicht möglich.
- Die Qualität der Interaktion ist nicht mehr werkzeugabhängig.
- Über Werkzeuge besteht immer noch die Möglichkeit der Fernkommunikation.
- Veränderung wird sofort registriert, womit auch die Antwort auf Veränderung so schnell wie möglich eintreten kann.
- Mit Heimarbeit auftretende arbeitsrechtliche Probleme gibt es nicht.
- Neben diesen unmittelbaren Vorteilen für agiles Arbeiten gibt es noch viele weitere Vorteile:
- Wegfall von Pendelzeit, wenn die Teams wohnortbezogen entwickelt und aufgestellt werden.
- Wiederbelebung von Unterzentren.
- Weniger Bürokosten in den hochpreisigen Oberzentren.
- CO2-Einsparung.
- Work-Live-Balance durch Möglichkeit, zwischendurch für Kind oder Freizeit die Arbeit zu unterbrechen.